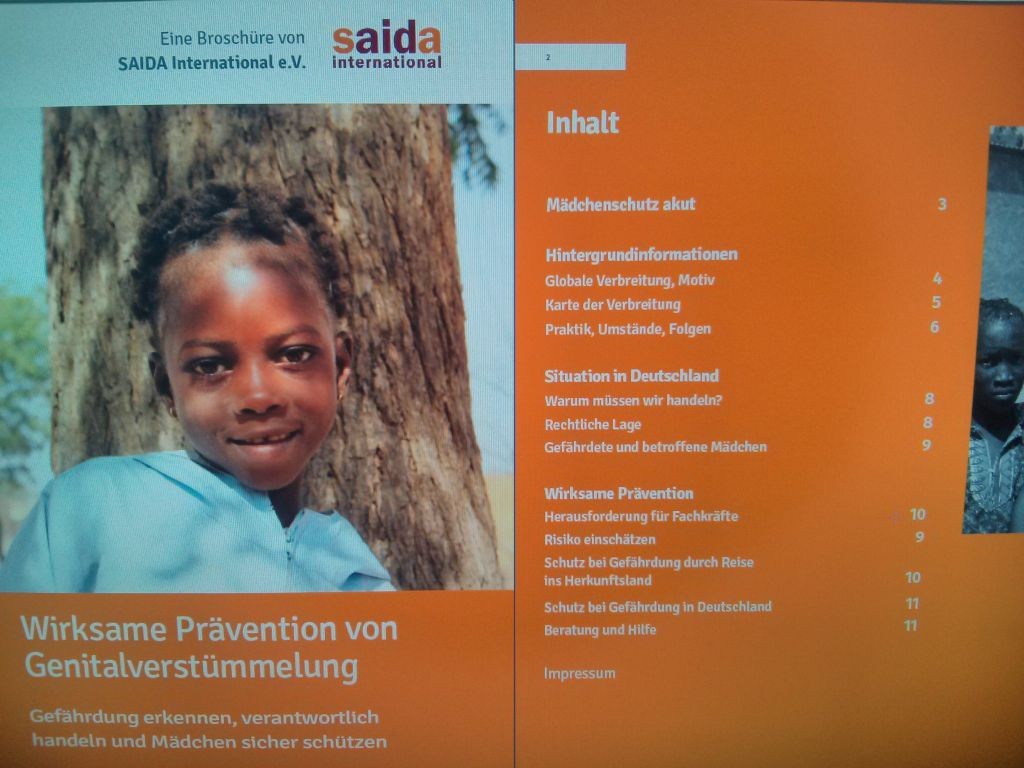In den Sommermonaten ist die Gefahr für Mädchen in Europa besonders groß, während Urlaubsreisen in die Herkunftsländer der Familie Opfer der Genitalverstümmelung zu werden. Je mehr Menschen zu dieser schwerwiegenden Kinderschutzproblematik sensibilisiert sind, desto größer sind die Chancen auf wirksamen Schutz für gefährdete Mädchen. Wir möchten Sie dabei unterstützen, eine mögliche Gefährdung richtig einzuschätzen und zum sicheren Schutz von Mädchen beizutragen.
In der Verhandlung wird nun unter anderem geklärt, ob das Wiederverschließen der Wunde als Verstümmelung gewertet werden kann. Wie auch immer der Prozess ausgehen mag, wird es in britischen Kliniken wohl gängige Praxis bleiben, die Frauen nach der Entbindung wieder zuzunähen.
Schlimm genug, dass der taz-Redakteur sich in eklatanter Verharmlosung ergeht ("Beschneidung von Frauen", "Frauen mit beschnittenen Genitalien", "Mädchenbeschneidung" etc.) - ob aus Ignoranz oder dem verfehlten Wunsch nach Anpassung an die Wünsche einer einzelnen Aktivistin bleibt wohl unklar). Klar ist aber, dass die Verwendung beschönigender Begriffe dem Kampf gegen dieses Verbrechen abträglich ist. Es wäre ein Leichtes für sämtliche Medien, bei der Berichterstattung durchgängig diejenigen Begriffe zu verwenden, die der Praktik gerecht werden (nämlich "Genitalverstümmelung" und "verstümmelte Genitalien") und damit sowohl den Forderungen der afrikanischen Aktivisten Rechnung zu tragen als auch den Opfern Respekt zu zollen (siehe dazu Bagatellisierung durch Sprache).
Über SAIDA International e.V.
SAIDA International e.V. setzt sich seit 2010 für Frauen- und Kinderrechte ein. Im Mittelpunkt steht der Schutz von Mädchen vor Genitalverstümmelung und Kinderehe – in Deutschland und weltweit. Mit der SAIDA Fachberatungsstelle, SAIDA mobil und dem SAIDA Kompetenzzentrum leisten wir Prävention, Schutz, Beratung, Versorgung und Fortbildung.
Kontakt
- SAIDA International e.V., Delitzscher Str. 80, 04129 Leipzig
- 0341 24 74 669
- info@saida.de
- saida.de
- auf Google Maps finden